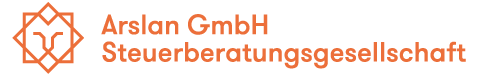Die Eheleute waren beide im Rahmen eines Minijobs bei einer Kirchengemeinde tätig. Die Ehefrau meldete im Jahr 2016 ein Gewerbe „Grabpflege und Grabgestaltung“ als Einzelunternehmerin an. Der Ehemann meldete im September 2016 ebenfalls ein Gewerbe „Grabpflege und Grabgestaltung“ an. Beide Eheleute nahmen in ihren Umsatzsteuererklärungen die Kleinunternehmerregelung in Anspruch. Sie erzielten jeweils Umsätze unterhalb der Kleinunternehmergrenze (17.500 Euro). Das Finanzamt war der Auffassung, dass ein einheitliches Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes vorlag und die Kleinunternehmergrenze deshalb überschritten sei. Die Anmeldung des zweiten Gewerbes durch den Ehemann sei ausschließlich mit dem Ziel erfolgt, die Umsatzgrenzen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nicht zu überschreiten. Die Eheleute hingegen sahen keine missbräuchliche Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung. Grabpflegeleistungen habe die Ehefrau im Rahmen von „Daueraufträgen“ erbracht, während ihr Ehemann Grabgestaltungen und vereinzelt Schneidarbeiten durchgeführt habe. Wenn vereinzelt eine Pflege- oder Gestaltungstätigkeit durch den anderen Ehegatten erbracht worden sein sollte, sei dies auch unter Fremden üblich und führe nicht direkt zu einem einheitlichen Unternehmen.
Bei der Beurteilung, ob die Inanspruchnahme zweckwidrig ist, ist laut Finanzgericht Münster auch zu beachten, dass ein Steuerpflichtiger nach höchstrichterlicher Rechtsprechung das Recht hat, seine Tätigkeit so zu gestalten, dass er seine Steuerschuld in Grenzen hält (Az. 15 K 2500/22). Dementsprechend macht allein das Bestreben, Steuern zu sparen, eine rechtliche Gestaltung nicht unangemessen, solange die gewählte Gestaltung zumindest auch von beachtlichen außersteuerlichen Gründen bestimmt gewesen ist. Demzufolge war eine künstliche Aufspaltung vorliegend nicht zu erkennen. Vielmehr hat die Ehefrau in für das Gericht nachvollziehbarer Weise außersteuerliche Gründe für die gewählte Gestaltung dargelegt.